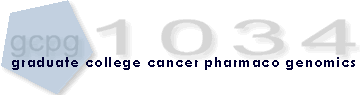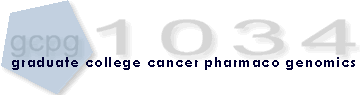Die Abteilung Klinische Pharmakologie konzentriert
sich auf die Frage, welche Enzyme und Transportsysteme für
die bekannte große
Variabilität in Wirkspiegeln, in Wirkungen und in Nebenwirkungen
von Zytostatika verantwortlich sind. Die zugrunde liegenden genetischen
Polymorphismen sollen identifiziert und charakterisiert werden.
Das soll im Rahmen dieses Graduiertenkollegs an zwei ausgewählten
Pharmaka, Melphalan und Cytosinarabinosid, untersucht werden.
Für
diese Medikamente ist eine große Variabilität in Blutkonzentrationen
und Wirkungen dokumentiert, für Cytosinarabinosid sogar
eine trimodale Verteilung der Blutkonzentrationen, was eine monogene
Ursache
der Variabilität suggeriert. Es soll also mit biochemischen
(enzymkinetischen und transportkinetischen) Methoden anhand menschlicher
Blutzellen und anderer Zellen nicht verwandter Spender ex-vivo
sowie mit klinisch-pharmakologischen und pharmakokinetischen
Methoden an
krebskranken Patienten in-vivo untersucht werden, welche Enzyme
und Transportsysteme für die pharmakokinetische Variabilität
der Pharmaka verantwortlich sind.
Diese Projekte eignen sich hervorragend als Dissertationsthemen,
da ein breites Spektrum von Methoden wie Enzymkinetik, Transportkinetik,
Pharmakokinetik am Patienten, Konzentrationsmessungen mit HPLC
und massenspektrometrischer Detektion, Analytik der DNA auf
Polymorphismen, Analyse der Expressionsvariabilität (RNA und Protein), und
die entsprechenden Verfahren der Biostatistik und Bioinformatik
für
eine spezifische Frage angewendet wird; alle erforderlichen Methoden
sind innerhalb der Abteilung oder des Graduiertenkollegs gut
etabliert. Sofern sich funktionell bedeutende Varianten finden,
wird die Bedeutung
diese Befunde in der Regel weit über das spezifisch untersuchte
Zytostatikum hinausgehen.
Stand der Forschung
Das Alkylans Melphalan stellt eine der Säulen in der Therapie
des Plasmozytoms dar und wird auch beim malignen Lymphomen (siehe
3.2.2) eingesetzt. Es hat erhebliche interindividuelle Unterschiede
in der Pharmakokinetik, in der Intensität der Nebenwirkungen
und im Ansprechen der Tumorerkrankung (Choi et al., 1989). Es
ist bekannt, dass spezifische Transporter für neutrale Aminosäuren
vom L- und T-Typ wie LAT1, LAT2 oder TAT1 (Kanai et al., 1998,
Kim et al., 2002, Segawa et al., 1999) und wahrscheinlich auch
Transportproteine
organischer Kationen, die für die zelluläre Aufnahme
und die renale Ausscheidung von Melphalan verantwortlich sind.
Mittels
radioaktiv markierten Melphalans bzw. der durch die gleichen
Transporter transportierten Aminosäure Phenylalanin soll
hier nun die Transportkinetik von Zellen unverwandter gesunder
Probanden und von Tumor-Patienten
untersucht werden, der quantitative Anteil der möglicherweise
beteiligten Transporter abgeschätzt werden. Die Transportaktivität
soll mit den genetischen Polymorphismen sowie mit Genexpressionsdaten
in Beziehung gesetzt werden, um die Ursachen der Variabilität
zu klären.
Nucleosidanaloga werden in der Therapie akuter Leukämien,
lymphoproliferativer Erkrankungen und auch solider Tumoren eingesetzt.
Für das Pyrimidinanalogon
Cytosin-Arabinosid und für das verwandte Medikament Gemcitabin
ist eine interindividuell hochgradig variable Pharmakokinetik
bekannt, deren Ursachen bislang ungeklärt sind. Das Schlüsselenzym
in der Aktivierung ist die Deoxycytidinkinase. Zellen, die dieses
Enzym nicht besitzen, sind gegenüber Cytosin-Arabinosid
resistent. Der Schlüsselschritt in der Deaktivierung ist
die Desaminierung über
die Cytidindeaminase. Es gibt erste Hinweise auf Polymorphismen
in der Cytidindeaminase (Yue et al., 2003). Die bei Europäern
relevanten Varianten und die Bedeutung für die trimodale
Verteilung der Blutspiegel sowie für die Variabilität
der Wirkung sind aber noch nicht untersucht. Als weitere wesentliche
Kandidatengene
sollen Nukleosid-Transporter analysiert werden, die Pyrimidine
in Zellen hineintransportieren. Der Transporter hENT1 soll an
menschlichen
Blutzellen gesunder Probanden auf funktionelle Variabilität
hin untersucht werden. Parallel soll das entsprechende Gen auf
Polymorphismen hin untersucht werden und anschließend soll
in klinischen Studien geklärt werden, ob die dabei identifizierten
Varianten tatsächlich
medizinische Bedeutung für Wirkungen und Nebenwirkungen
von Cytosinarabinosid oder Gemcitabin haben.
Weiterführende Literatur